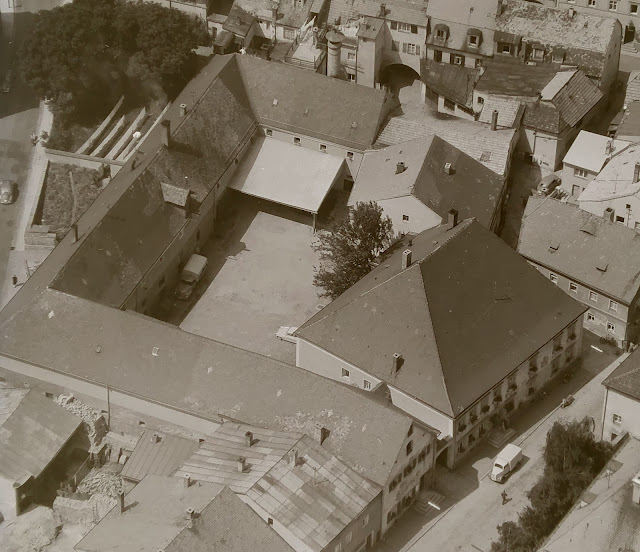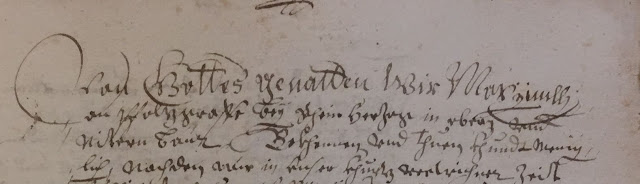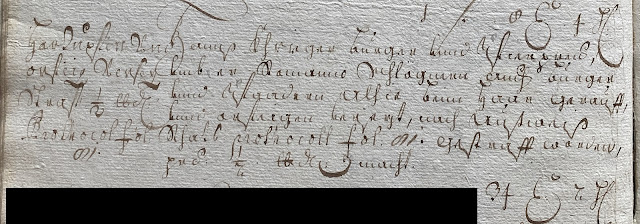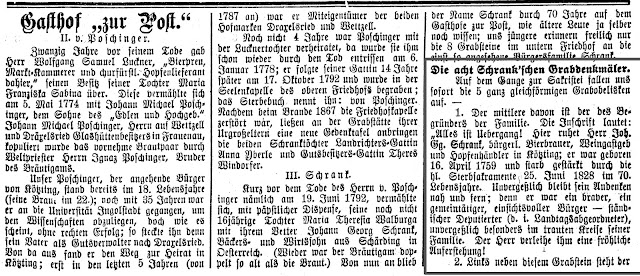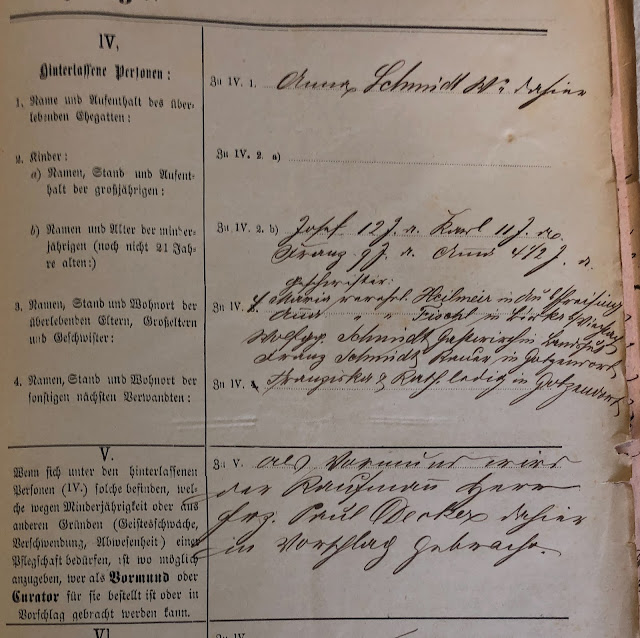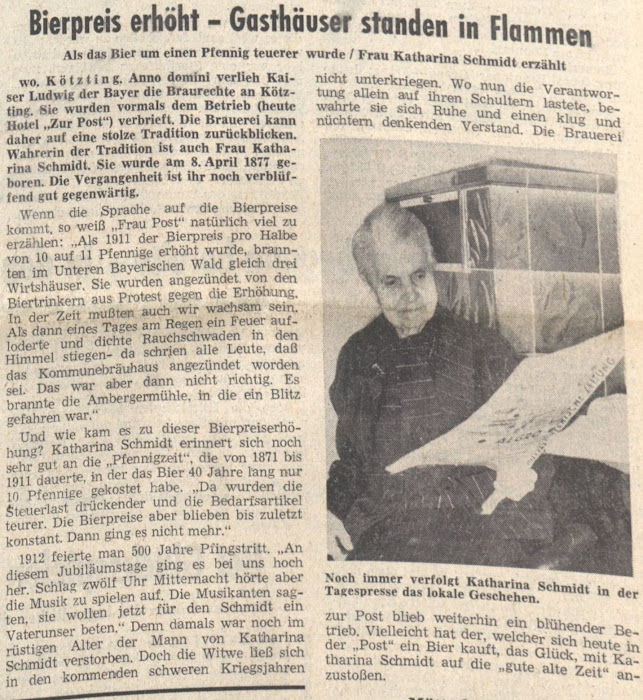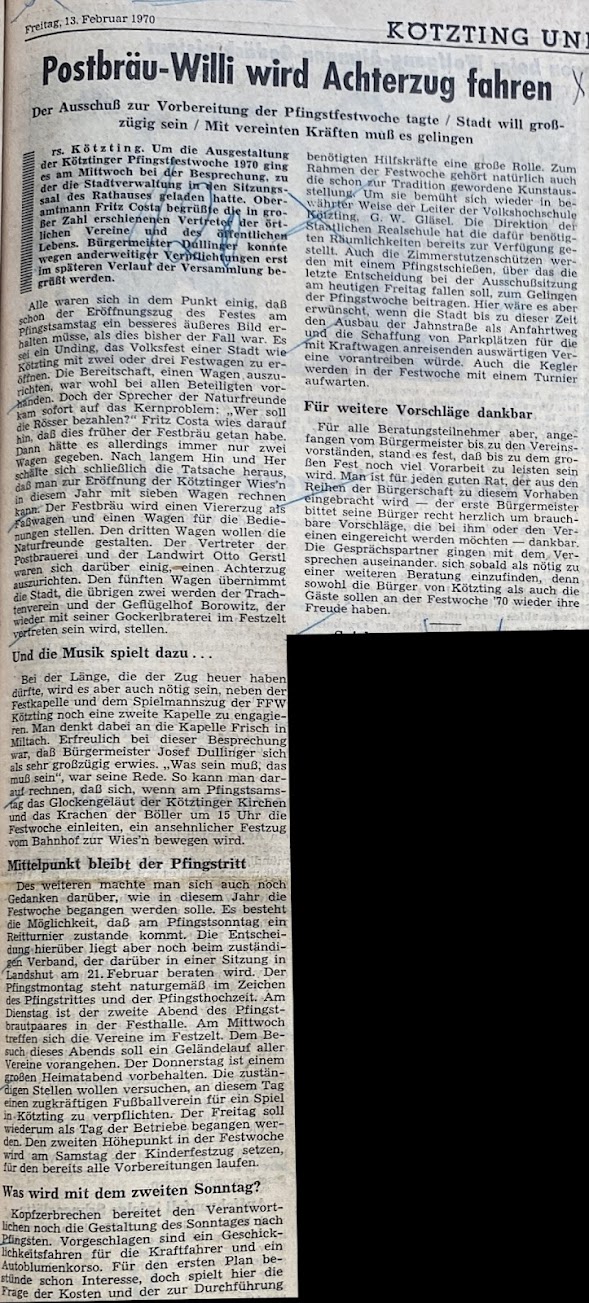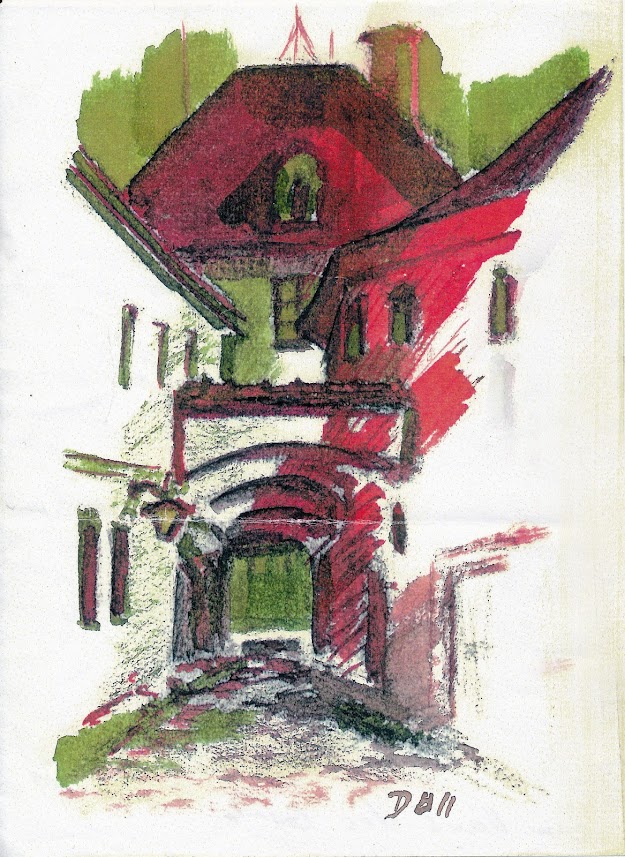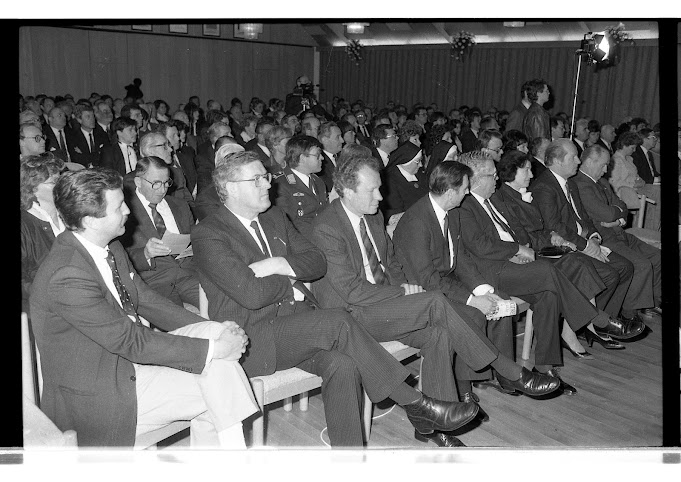Immernoch im Jahre 1700 stehen der Amtskammerer Hans Märkl und der Bierbrauer Krieger vor Gericht, weil sie sich öffentlich gegenseitig als "
" bezeichnet hatten. Gemeinschaftlich hatten sie 1 1/2 Pfund Pfennige als Strafe zu tragen.
Seine Frau, die Agnes, steht ihrem Manne in ihrer Energie in nichts nach und muss - wir sind immer noch im Jahre 1700 - ein ganzes Pfund Pfennige bezahlen dafür, dass die "
" hatte. Diese wiederum, also Elisabeth Dürr, gab der Frau Krieger in gleicher Münze zurück, nannte sie eine "
", musste dafür jedoch nur 1/2 Pfund Pfennige als Strafe bezahlen, damals zwei Tagelöhne eines Handwerkers..
Zusammen mit dem Kötztinger Schuhmacher Andreas Zissler - siehe oben - stand Johann Krieger im Jahr drauf erneut wegen einer Rauferei vor Gericht...... und so gehts munter weiter.
Wir nähern uns zeitlich dem Spanischen Erbfolgekrieg und nun wird der kapitalkräftige Gastwirt und Brauer mit seiner zentralen Lage im Markt zum großen Kriegsgewinnler.
Der Spanische Erbfolgekrieg
1703, nach der Niederlage der bayerischen
Truppen und den nachfolgenden laufenden Einquartierungen der fremden Soldaten, wohnten die Herren Offiziere der österreichischen Armee mit ihrem
Gefolge im Anwesen des Johannes Krieger und ließen es sich gut gehen. Die Mannschaften und niederen Dienstgrade
wurden auf die anderen Bürgerhäuser in Kötzting verteilt. Auf Befehl der
siegreichen Armeen mussten die Kötztinger Bürger Tagesrationen an die fremden
Soldaten zahlen, in Geld bzw. Naturalien. Die Offiziere wurden außergewöhnlich
hoch entlohnt und gaben dieses Geld beim Krieger mit vollen Händen aus. Reichte die Summe nicht
und wollten sie es sich doch weiterhin noch gut gehen lassen, so ließen sie einfach
anschreiben und, nach Abzug der Truppen, präsentierte der Wirt, Krieger Johann,
die Rechnung beim Magistrat, und so tauchte der Betrag dann im märktischen
Rechnungsbuch als Ausgabe auf.
„Dem Husaern Obristleutnant sogenannt Basikar hat man als
er ander mahl nach dem Einfahl ins Schloss anhero kommen auf dessen begehren 3
Khöpf wein und 4 Köpf Salz reichen und der Hansen Krieger alhir fuer iedes Köpf
Wein 20 xr in allem bezahlen miessen.
So seint dem H:
Johannistag 3 Husaern Offizier in aller Eill under der Kürchenzeit ankomben und
die Einkher beim Krieger genomben, welche neben denen Knechten verzöhret 1
Gulden 51 Kreutzer“
|
Eine Kuriosität am Rande dieses Kriegszuges passierte am Heiligen Abend 1703
„Als an H: Abent 2 Compagn kayl: Husaern von Pöhamb heraus und das Nachtquartier zu Hovern, Perndorf und Aernpruckh genomben, Volgents aber nacher Passau marschiert, ist alhir bey dernacht, wie sonst an der H: Christnacht gebreuchig ain Schuss beschechen, von welchem sye vermaint es seye Bayr: Voelckher verhanden und zumahlen dann derentwillen die ganze Nacht hindurch 6 biss 8 Husaern Regnoscierung [Erkundingung] geritten, hat man ihnen uf begehrn an Pier und Prandtwein raichen miessen 54 Kreutzer“.
|
Mussten
Kontributionen gezahlt werden so traf das jeden Marktlehner
mit dem selben Betrag. Die Söldner und Häusler zahlten zwar weniger, aber
trotzdem musste jeder dasselbe zahlen, unabhängig von seiner sonstigen
Wirtschaftskraft. „Wie der
Comissarij Syess widerumben von Marckht zum 6 monathlichenWüntter Quartiers
Contingent 800 fl begehrt und solche bis uf 450 fl herunder gebetten worden hat
mann weillen under der Bürgerschaft nur 300 fl zusambbringen gewest zu
Umbgehung des angetrohten Arrests und Execution... den Yberrest von Herrn Pfleger alhir
entlehnt mit 150 fl“.
Beim
Pfleggericht wurde
also eine Anleihe aufgenommen, um die verlangten Gelder bezahlen zu können. Es
sollte damit verhindert werden, dass zur Erzwingung der Bezahlung zuerst der
Magistrat eingesperrt und dann auch noch die Bürger Einquartierungen hätten aushalten müssen. Die Sondersteuern
wurden nicht, so wie heutzutage zu vermuten, nach der Höhe des persönlichen
Einkommens erhoben, sondern die Marktlehen, Sölden und
Häuser waren
nicht nur eine rechtliche sondern auch eine steuerliche Größe. Alle
Marktlehner, ob bettelarm oder wohlhabend, hatten denselben Betrag zu zahlen. Für manche
Marktlehner waren diese Zeiten existenziell und sie kamen sprichwörtlich um
Haus und Hof, für andere war es eine gute Möglichkeit Geld zu verdienen. Sogar der Markt war gezwungen, Immobilien aus seinem Besitz verkaufen, um seine Schulden bezahlen zu können und bares Geld hatte zu der Zeit fast immer nur eine Person: Johann Krieger.
„die
unumbgängliche Notturfft hat erfordert Hannsen Krieger Bürger und Pierpreunen
alhir wegen der Bezahlung yber obige Einquartierung dem Markht weithers von
Camb zu repartierte 10 Man die Portiones die sogenannte 2 Lärenpecher und 2 Rabenweyer zuverkhauffen dahero beisambt dem Leykhauff
eingangen : 454 fl
Dieses Geld wurde dringend benötigt, denn:
Beim Abmarch der
Königl: Preussischen Truppen hat man denen alhir inquartiert gewest 75 muendt
portiones (=Tagesrationen)
vors Monath Apprill bezahllen mithin mehrmallen ain anlage einbringen muessen :
481 fl“
Das Geld für die an
Krieger verkauften Weiher hatte also nicht einmal dazu ausgereicht, um auch nur eine einzige der vielen
Kontributionszahlungen zu erfüllen.
Noch im Jahre 1703 hatte er einem seiner Billich-Verwandten einen sehr umfangreichen Grundbesitz abgekauft. Hans Georg Billich veräußerte den "von seiner Ahnfrau Maria Billichin, gewester Cammerin, an sich gebrachter Theill in 6 Äckern und 1 Wiese" um 130 Gulden.
Die Kötztinger
Bürger, so wie alle anderen in Bayern, wurden von den feindlichen
österreichischen Truppen mehrere Jahre lang vollständig ausgeplündert
und mussten anfangs sogar den fremden Soldaten noch helfen, den Markt gegen die
anrückenden bayerischen Soldaten verteidigungsfest zu machen.
|
„Auf Anschaffung der alhir in Quartier gelegenen Husaern haben in aller Eill alle Gässen mit Schrankpaumen und Bollisäten vermacht werden miessen, davon man 3 Zimmerleith bezahlt Und umb willen die Husaern alle Nacht bey St. Veith ein Wachtfeuer gebraucht hat man von Georg Finckhen 4 Fuether Prennholz von Wäzlholz hereinfuehren lassen und dem Fuhrlohn bezahlt und weillen das Holz zu obigen Wachtfeuer nit verklöckht, hat man notwendiger weis von Franzen Waldherr Holz erkhauffen miessen 45 kr“..
|
Auf dem heutigen
Marktplatz brannte, bei ansonsten völliger Dunkelheit, ein Lagerfeuer, das die
Kötztinger Bürger zu unterhalten hatten und beim Krieger ließen die Offiziere,
allerdings bei anderer Gelegenheit, anschreiben: „Zu Erhaltung guetten commando auch das die zu
Vorspann verschafft Pferdt wider zurueckgelassen werden mechten,hat man an
ienigen 130 fl Gelt so Herr Obristleutnant Millpeckh beim Hansen Krieger alhir
anstehent gelassen mit Verwilligung aines gesambten Rats und Ausschuss erlegt.“ Der Herr
Obristleutnant hatte also kräftig anschreiben lassen, damit man aber weiterhin
gut miteinander auskommen möge und vor allem damit die zum Vorspann verliehenen
Pferde auch ja wieder zurückgegeben werden würden, hat der Markt die Summe übernommen
– und die beim Krieger aufgelaufenen Summen bezahlt.
Überblickt man die
überlieferten Listen an Kontributionszahlungen in den Archiven, so ist es
schier unglaublich, was die Bürger Kötztings an Geldsummen haben aufbringen
können. Wohl durch Mobilisierung der letzten Geldreserven und Aufnahme immer
neuer Schulden bei den verschiedensten Geldgebern überstanden die Bürger auch
diese schwere Zeit, allerdings zumeist vollständig verarmt.
|
Die Familie Luckner kommt ins Spiel Am 17.8.1706 hatte Herr Samuel Luckner aus Cham die erst 16jährige Franziska Billich, Tochter aus der ersten Ehe der nunmehrigen Frau Agnes Krieger geheiratet.
Frau Krieger, vorher verheiratete Billich und nun eine geborene Mauerer aus Cham, hatte wohl andauernde und gute Verbindungen zurück in ihre Heimatstadt behalten und so zog Franzsikla Billich im Jahre 1706 nach Cham, bekam dort mit ihrem Mann insgesamt 8 Kinder, 6 Söhne und zwei Töchter. Der älteste der Söhne war Wolfgang Samuel Luckner, der spätere Kötztinger Kammerer. Der zweitjüngste der Söhne wurde auf den Namen Johann Niklas getauft. Aus ihm wurde später der berühmte Sohn Chams: Graf Luckner.
Dies alles liegt jedoch noch in der Zukunft, nur die Hochzeit und der Auszug der jungen Tochter ist hier zu diesem Zeitpunkt relevant.
Einschub Ende
|
Wie schon seine Vorgänger auf der Privatbrauerei, bekam auch er es mit der "Bierkontrolle" des Magistrats zu tun und wurde im Jahre 1704 kräftig bestraft, weil er "vor Michaeli wider die Gebuehr praunes Pier gesotten und solches ohne Saz ausgegeben" hatte. Er hatte also - im Gegensatz zu den öffentlich kontrolliertem Kommunbrauhaus - schon vor der erlaubten Startzeit (=Michaeli) begonnen Bier zu brauen und hatte dieses danach auch noch gleich verkauft, ohne die vorgesehenen Abgaben zu leisten. Und dies vor dem Hintergrund, dass die restlichen Gasthäuser Kötztings zu dem Zeitpunkt nur noch das alte und vermutlich ziemlich schale Bier in ihren Kellern lagern hatten.,
Doch zurück zu den schweren Zeiten für die Kötztinger Bürger.
In einer ganz anderen Situation befand sich Johann Krieger, wie oben bereits angeführt, war er kapitalkräftig, während seine Mitbürger Immobilien verkaufen mussten, um sich zu finanzieren. Im April 1706 konnte er einer seiner Stieftöchter 1221(!) Gulden an Heiratsgut auf einen Schlag ausbezahlen und als im August desselben Jahres seine zweite Stieftochter nach Cham heiratete wird sie sicherlich mit einem ähnlich hohen Betrag ausbezahlt worden sein.
Die Liste der Grundstückskäufe ließe sich noch weiter fortsetzen. Wichtiger jedoch war seine Erwerbung vom 21.10.1710. Unter diesem Datum kaufte er um 537 Gulden den Gschwandhof zu seinem Besitz hinzu, einen der Kötztinger Urhöfe, rechtlich gesehen ein Marktlehen, was für ihn einen ganz besonderen Vorteil bot. Eine zusätzliche besondere Eigenschaft hatte der Gschwandhof zusätzlich, die ihn gegenüber allen anderen Anwesen Kötztings auszeichnete. Der Gschwandhof hatte zwei „Afterlehen“. Es gab also lehenpflichtige Vasallen zu diesem Hof. Es waren dies, zwei Bauernhöfe, deren Besitzer an den Eigentümer des Gschwandhofs Abgaben zu zahlen hatten. Es waren dies das Wirtshaus in Rappendorf und ein Hof am Auhof. Einen Monat nach dem Kauftermin bezahlte Johann Krieger die komplette Kaufsumme für den Gschwandhof auf einmal in bar.
 |
| StA Landshut Markt Kötzting Briefprotokoll B5 Kopf der Verkaufsurkunde über den Gchwandhof über 537 1/2 Gulden von Martin Hofmann an Johann Krieger im Jahre 1710 |
Nun war er,
geschäftlich gesehen, in einer ganz neuen Situation. Durch den Besitz eines
Marktlehens und seiner Privatbrauerei hatte er nicht nur das Braurecht im
Kommunbrauhaus sondern konnte durch sein eigenes Brauhaus schalten und walten wie er wollte. Folgerichtig
stellte er den Antrag, sein privates Anwesen und den Gschwandhof zu einer
Einheit zusammenfassen zu dürfen. Bisher war es in Kötzting üblich gewesen,
dass brauende Bürger, die nicht nur das Braurecht ausübten sondern auch einen
Ausschank betrieben, sich gegenseitig mit Kellerlagerraum aushalfen.
Die Kötztinger
Bürger behaupteten im Prozess, dass sie früher manchmal sogar im Gschwandhofkeller - beim „Hofmann“ - Fässer einlagern hätten dürfen. Dies wäre nun nicht mehr möglich,
weil Johann Krieger in seinem eigenen Brauhaus einen Sud nach dem anderen
braue und anschließend das Bier im Gschwandhofkeller lagere. Alljährlich durfte
eigentlich erst ab Michaeli mit
dem Bierbrauen begonnen werden. Im Kommunbrauhaus, mit seiner kommunalen Aufsicht, musste
natürlich diese gesetzliche Regelung genauestens eingehalten werden. Anders beim
Kriegerbrauhaus. Dieser begann
regelmäßig - wofür er ja, siehe weiter oben, auch bereits seine Strafe hatte zahlen müssen, - so die Anklage seiner Gegner, 10 Tage früher mit dem Brauen und
konnte so, lange bevor die anderen Wirtshäuser Bier anbieten konnten, oder auch
zu manchen Zeiten wenn die Mitbürger aus Mangel an Rohstoffen das Brauen hatten einstellen mussten, immer ausreichend Bier zur Verfügung stellen und damit den
anderen das Geschäft verderben.
Dagegen liefen nun
alle anderen Marktlehner Sturm, bestanden auf dem alten Herkommen und meinten
„.... dass aber dieses (das Zusammenschließen von Gschwandhof mit seinem
Hauptanwesen) als das Hauptwerch dem Krieger nit anstehen oder gefallen
will, hat er destwillen unser der bräuenden Bürgerschaft Anbringen und
nottringliches Erindern [Klageschrift] nur vor ein lauther S.V.
Lügenwerch gehalten. Aber müssen ihme dieses als anseithen seiner schon
gewohneten Luftstraich auch darumb zu guet halten und vorbeygehen lassen,
seithemallen sich Krieger wegen seines Reichtums selbsten nicht mehr kennet und
nebenbey marktkundig ist, dass sein Kriegers wortt nit iedesmahllen ein
Evangelische Wahrheit seyen.“
Krieger meine wohl,
so sagten seine Gegner, er könne in Kötzting machen was er wolle. Vorwürfe genau dieser Art hatte es fast wortgleich schon vorher gegen die Billichs gegeben und wird es auch später gegen den Enkel Wolfgang Samuel Luckner gegen.
Die Mitbürger
Kriegers waren empört über seine Absichten, da sie ja schon Jahre zuvor
versucht hatten gegen seine Brauerei anzugehen. Den brauberechtigten Bürgern Kötztings war er schon früh ein
Dorn im Auge, da er auch an einige Wirthäuser in der Umgebung Bier lieferte und sie
zweifelten die Berechtigung dazu an, denn schließlich hatte der Markt Kötzting in seinen Freiheitsrechten den
alleinigen Bierverschleiß im weiten Umkreis zugestanden bekommen. Das Pfleggericht setzte einen Untersuchungstermin an und
Johann Krieger konnte ohne Probleme Zeugen aufbieten, die Bierlieferungen
seines Bräuhauses an Gastwirtschaften, vor allem im Zellertal und nach
Thenning, schon seit den Zeiten des „alten als jungen Billich“
bestätigen konnten.
Seine neue Absicht aber den Gschwandhof mit der Privatbrauerei zu
verbinden brachte nun buchstäblich das Fass zum Überlaufen.
- Die Einnahmen beim Kommunbrauhaus, die
zur Hälfte der Marktkammer zuflossen, seien von 775 Gulden auf nur noch
410 Gulden in den Jahren 1708 bis 1714 zurückgegangen.
- Krieger sollte im Gschwandhof, wenn er
schon noch mehr brauen wollte, nur das Bier einlagern dürfen, dass er im
Kommunbrauhaus auch selbst hatte brauen lassen, und dafür auch die
entsprechenden Gebühren, „die Composition dafür abzuführen, dessen sich
Krieger in sein Herz hinein schämen sollte, dass er als ein vorher
wohlhabender Mann... versucht die Bürde auf uns zu schieben. Volglich uns
hiermit gar zu ruinieren suechet. Dieses schmerzte die Bürger und so
rechneten sie ihm vor, dass doch noch bewusst ist, dass er vor dem
Krieg, nit allein von denen Gotteshäusern, sondern auch von anderen Orthen
Gelt entlehnen müssen. Seithero aber 2 Töchter ausgeheiratet und ieder
1000 fl bezahlt, ohne was der Sohn beim Studium gecostet. Die
Marktlehner meinten, dass er 4000 fl hineingehauset habe.... sonderbar
wegen der gehaltenen Hauptquartier. Während alle anderen Bürger mit
Brandenburgischen Soldaten belegt waren, hätte er Krieger
gar nicht genug braunes Pier sieden und Pranntwein prennen können.“
- Darüber hinaus hätte er aus einem
Nebengebäude, das Mitte des 17. Jahrhunderts zum Gebäudekomplex hinzugekauft worden war, „ein anseheliches Pallasst erpauth“. Und
die Mitbürger sahen voraus, dass dies nicht nur für das Hauptquartier
nötig war, „sondern er hat es also erpauth, dass er mehrer Gäst bey
seiner Würtschafft sezen: auch er Krieger hinein eine Acomodet: und
Schlafkammer haben khönne.“ Obwohl auf diesem Haus keinerlei
Gerechtigkeiten Herkommens waren, wolle er alle Hochzeiten und alle Feiern
an sich ziehen und die Gemeinschaft der Bürger schädigen, obwohl die
Marktlehner immer schon diese Feiern im Wechsel ausrichten konnten.
Bei all den
Schwierigkeiten, die die brauberechtigten Bürger mit Johann Krieger hatten, so
würden sich diese noch vergrößern, wenn die Rechte des Gschwandhofes als
Marktlehen auch auf die Bräustätte übertragen werden durften, was sie, „sambentlich
preuente Bürgerschafft zu Kötzting, untertänigst“ zu untersagen erbäten.
Es war aber so, wie im heutigen Leben auch manchmal, Krieger war zu mächtig und konnte viele seiner "Rechte" als herkömmlich belegen UND das grundsätzliche Recht eines Marktlehners, das er ja nun durch den Erwerb des Gschwandhofes belegen konnten, konnten und wollten i9hm auch die anderen Marktlehner natürlich schlecht abstreiten.
|
Der große Marktbrand von 1717Kötzting litt noch immer unten den Nachwirkungen des Spanischen Erbfolgekriegs als es am 25.9.1717 zu einem verheerenden Marktbrand kam, der - ähnlich wie 1867 - eine komplette Seite des Marktes in Schutt und Asche legte. Aber was passierte dabei....... fast der ganze Markt war betroffen, nur nicht die Anwesen in der heutigen Herrenstraße und so konnte die Familie Krieger munter weiterwirtschaften, während die Kötztinger Bürger mit dem zähen Wiederaufbau beschäftigt waren.
Pater Gregor schrieb vom Pfarrhofaus an seinem Abt im Kloster Rott “... als am itzt verflossenen Sambstag (25.09.1717) dem 25. abens umb 8 Uhr zu nachts ist bey Herrn Riederer durch Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit Feuer im Stadl auskommen, welcher gleich dergestalt ueberhand genommen, das in einer halbe Stund der grosse Tractus bis zum Tirrigl Haus hinauf und hinab bis zu dem Spitall vom Schmidtstaller in voelligen Brand geraten und alles in Grund und Poden zusammenverprennen sambt allen Städeln Getraidt, Heu und Grainedt. Wir haben uns nicht anders eingebildts als der ganze Marckht der Pfarrhof sambt dem Traidtstadl verbrinnen wuerdt“. Da Pater Gregor die Feuerwalze auch auf die Kirche und den Pfarrhof zurasen sah, ließ er das Gebäude räumen und alle Möbel in den Keller bringen, er selber aber „ist mit dem hochwürdigsten Gut dem entsetzlichen Feuer entgegengestanden. Da hat sich der Wind gewendet und den heruntern Thail gegen uns nit angegriffen.“ Drei Tage lang hatte das Feuer gewütet, „21 Häuser und Marktlehen, und zwar die besten, sind abgeprunnen.“ Aus heutiger Sicht ist die ganze Häuserzeile der aufwärts gesehen linken Markstraßenseite in Grund und Boden verbrannt worden, vom Kaufhaus Wanninger bis zu Tabak Liebl.(Marktstraße 9) Bevor das Feuer auch den unteren Markt und die Herrenstraße zerstören konnte, drehte der Wind, wie oben berichtet. In weniger als 100 Jahren war Kötzting mehrmals zerstört, längere Zeit über besetzt und auch ausgeplündert worden, und immer waren diese Krisenzeiten für die Besitzer dieses Anwesens entweder wirtschaftlich von Vorteil oder sie waren zumindest nicht so belastend wie für ihre Mitbürger.
|
Gegen Ende seines
Lebens hatte Krieger Johann, noch als Kammerer, für sein und seiner Ehefrau
Seelenheil die Kapelle im
oberen Friedhof bauen lassen und vermachte als „ewigen“ Jahrtag den
Ertrag zweier Wiesen der Pfarrkirche Kötzting.
 |
Stadtarchiv Bad Kötzting AA IX-3 Anbau eines Leichenschauhauses an die Friedhofskapelle. Der linke Teil des Gebäudes war die von den Kriegerschen Eheleuten gestiftete Seelenkapelle, die dem Marktbrand von 1867 zum Opfer fiel, der rechte war ein Anbau aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts zum Zwecke der verpflichtend eingeführten Leichenbeschau..
|
Im Einzelnen verfügten die Beiden: "Ich, Johann
Krieger Pierpräu und zur Zeit Kammerer alhier zu Kötzting und mit Ihme ich
Agnes dessen Eheconsortin haben hernach
folgende Disposition abgeschlossen": Jedes Monat soll
eine Seelenmesse in
dem „von uns erbauthen obern Seelhaus“ gelesen werden. Diese „ewigen“
Messen wurden finanziert durch eine, auch den Nachbesitzer bindende, dauernde
Hypothek von 200 fl auf die Marktmühlwiese und
den Hammeracker. Diese Hypothek sollte jährlich mit 15
Gulden verzinsen werden. Am 7. Juni 1727
verstarb dann in Kötzting der ehemalige Kammerer, Braumeister und Hopfenhändler Johann Krieger.
 |
PfA Kötzting Band 18 Seite 37
"Am 7. wurde der Bürger und ehemalige Kammerer Johannes Krieger in Kötzting begraben." |
Drei Jahre später,
am 30.06.1730, starb in Cham der dortige Kammerer Samuel Luckner, der Vater unseres Wolfgang Samuel Luckners, im
Alter von 47 Jahren.
Bis dahin hatte Agnes Krieger den Betrieb alleine weitergeführt. Nun zog ihre Tochter, die Witwe Samuel Luckners, mit den vielen Kindern in ihren Heimatort nach Kötzting, zur Großmutter der
Kinder. Franziska Luckner heiratete in Kötzting zwar noch ein zweites Mal, nämlich 1732 Franz Alexander
Wissmann aus
Donaustauf, der aber außer zur Sicherstellung seines
eingebrachten Heiratsguts keinen darüber hinausführenden Besitzanteil am
Anwesen erhielt. In den Kötztinger Rechnungsbüchern steht unter ihrem Namen ein
ganz besonderer, einmaliger Eintrag. Als sie 1731 nach
Kötzting gezogen war und den Grundbesitz übertragen bekommen hatte, erwarb sie - als Frau - das Kötztinger Bürgerrecht und bezahlte dafür die ungewöhnlich hohe Summe von 19 Gulden. Dies
ist deshalb so außergewöhnlich, weil mir sonst kein einziger Fall bekannt ist, dass
in Kötzting einer Frau das Bürgerrecht verkauft und ausgesprochen worden ist.
 |
| StA Kötzting Marktrechnung von 1731 |
"Weyl Herrn Samuel Luckhner gewesten Cammerers zu Chamb seel hinterlassenen Wittib, Frauen Maria Franzsika Lucknerin von hier gebürttig, ist das Burgerrecht verlichen: und von derselben desstwegen Inhalt Rhats Prothocolls fol 7 erlegt worden 19 fl."
Doch nun weiter im Zeitablauf, am 12. November 1732 heiratete, wie oben bereits angeführt, die Gastgeberin und Witwe Maria Franziska Luckner, die Mutter unseres Samuel, ihren zweiten Ehemann, Herrn Franz Alexander Wissmann aus Forstmühle, Sohn des Jägers Johann Georg und seiner Frau Eva. Die damaligen Trauzeugen waren der Chamer Kammerer und der Chamer Zuckerbäcker Siber. Das Paar übernahm neben dem Kötztinger Gebäudekomplex auch den anderen Besitz, wie z.B. die Sölde und Taverne in Chamerau von der verwitweten Hopfenlieferantin Agnes Krieger. Diese Ehe sollte aber nicht lange dauern, denn am 14.02.1736 bereits verstarb die Wirtin Maria Franziska Wissmann in Kötzting, noch vor ihrer Mutter Agnes. Wolfgang Samuel Luckner, der Sohn - bzw. Enkel der Agnes Krieger - war nun 21 Jahre alt und konnte die Besitznachfolge seiner Mutter antreten.
|
Die Besitzverhältnisse Als Johann Krieger Mitte der 90er Jahre die Witwe Agnes Billich heiratete, hatte er lt Heiratsvertrag versprochen 1500 Gulden als Heiratsgut mit in die Ehe einzubringen. Erst am 2. Dezember 1713 ließ seine Frau Agnes ihm eine Quittung ausstellen, dass er sein Heiratsgut auch wirklich bezahlt hatte. Bis dahin wurden wohl alle finanziellen Mittel ge- und benutzt, umden Grundbesitz zu erweitern. Da der Heiratsvertrag der Krieger´schen Eheleute nicht mehr existiert - nur die ausgestellte Quittung nimmt Bezug auf einen solchen - , bei der späteren Besitzübertragung, an Samuel Luckner aber eine Vermögenssumme von 9000 fl errechnet wurde, so wird Herr Krieger mit seinem eingebrachten Heiratsgut wohl nur eingeschränkte Besitzrechte am Anwesen gehabt haben, aber eben uneingeschränkte Nutzungsrechte, und diese hat er, geschäftstüchtig wie er wohl war, bei passenden und passend gemachten Gelegenheiten, reichlich ausgenutzt.
|
Nun also Wolfgang Samuel Luckner, eine schillernde Person, die viele Charaktereigenschaften - gute wir schlechte - in sich vereinigte und ein echter Abkömmling der vielen Generationen Billich war.
Da es für ihn bereits einen eigenen umfangreichen Beitrag im Rahmen unserer Schilderaktion gibt, verweise ich hier nur auf den Link zu dieser Einzeldokumentation.
Auch andere Teilaspekte seines Wirkens sind bereits Thema eines Blogs geworden.
Der Kampf um die Reitensteiner Anteile
Der Bau der Herrensäge - Teil des Beitrags über den Lindnerbräu
Eine unbekannte Grablege Teil eins und Teil zwei
Einer der ganz besonderen Streitfälle, die Wolfgang Samuel Luckner geführt hatte, ist der mit dem Kötztinger Prior Mack und in den Streitakten befindet sich auch eine Grundrissskizze des Lucknerschen Gebäudekomplexes.
 |
| StA Landshut Rep 97e fasc. 793 |
In dem oben verlinkten Beitrag über Samuel Luckner sind viele seiner Leistungen aufgeführt. Es wird aber auch sein Prozessgebaren erwähnt. Vor allem sein Prozess gegen seinen Schwiegersohn, dem er seinen Besitz übergeben hatte, ist im Zusammenhang mit dem Anwesen interessant.
Im Jahre 1774 hatte Samuel Luckner sein Hauptanwesen in der Herrenstraße und all die Nebengebäude in der heutigen Holzapfelstraße an seine Tochter Maria Franziska und deren Ehemann Michael Poschinger übergeben. Der Gschwandhof - und seinen Hopfenhandel - hatte er für sich behalten. Dieses war auch wichtig, da er sonst seinen Status als Kötztinger Bürger verloren hätte. So konnte er auch noch 16 Jahre lang als Mitglied des Inneren Rates als Amtskammerer verbleiben und die Geschicke Kötztings nach seinem Willen beeinflussen. Weil er mit einigen Entscheidungen seiner erwachsenen Kinder - er hatte insgesamt 22 Kinder von drei Ehefrauen, von denen aber nur wenige das Kleinkindalter überlebten - nicht einverstanden war übergab er, um sie nicht groß auszahlen zu müssen, seinen Besitz weit, weit unter Wert an seinen Schwiegersohn, mit dem er sich schon wenige Tage nach der Übergabe überwarf und prozessierte. Für 7000 Gulden an Heiratsgut erhielt der junge Glashüttensohn einen Besitz im Werte von mehr als 43000 Gulden.
Michael Poschinger und Maria Franziska Luckner
Am 6. Mai 1774 heiratete der aus Drachslsried und Wettzell (Der Vater besaß die Hofmarken Drachselsried und Wettzell) stammende Michael Poschinger die Maria Franziska Luckner. |
| PfA Kötzting Band 14 Seite 201 |
Am 6. Mai schlossen den Bund der Ehe der noble und ansehnliche Herr Johann Michael Poschinger, ehelicher Sohn des ebenfalls ehrenwerten (nobilis weist auf einen Adelstitel hin) und ansehnlichen Herrn Johann Michael Poschinger, sitzend in Drachselsried und Wettzell und dessen Frau Anna Maria, die beide noch am Leben waren, mit der mädchenhaften Jungfrau Maria Franziska, eheliche Tochter des angesehenen Wolfgang Samuel Luckner, Ratsmitglied, Hopfenhändlers, Kammerers und Brauers aus diesem Ort und seiner Ehefrau Maria Magdalena - ebenfalls beide noch am Leben-. Die Trauzeugen waren Herr Josef Luckner, Bürger und Braumeister in Cham und Ullrich Anton Schöllinger, Bürger und Färber in Kötzting.
Die Trauung vollzog - nach erfolgter Erlaubnis durch den Kötztinger Pater Prior - Herr Ignaz Poschinger der Bruder des Brautvaters und ein Weltpriester.
Amüsant ist in diesem Zusammenhang ist eine zeitgenössische Hinzufügung im Heiratsvertrag. Nach dem Vertrag der Besitzübergabe an die Tochter wurde ein eigener Heiratsvertrag abgeschlossen und eine fremde Hand hat nachträglich noch das Adjektiv "tugendsam" beim Bräutigam dreifach unterstrichen.
 |
| StA Landshut Markt Kötzting B 36 von 1774 Heiratsvertrag über 7000 Gulden. |
Von Samuel Luckner selber kennen wir die genaue Dauer, wie lange der Friede im Hauses gehalten hatte: ganze 9 Tage ging es gut, dann verließ er das Haus unter Zurücklassung seines Hutes.
Luckner sprach in seiner Klageschrift von
des "bey meiner den 9ten Tage nach seiner Hochzeit unlaugbar beschechenen
Ausschaffung". Michael Poschinger hatte also seinen Schwiegervater aus dem Hause geworfen und dieser musste nun in eine Baustelle auf dem Gschwandhof einziehen, den er offensichtlich in Ruhe für sich hatte herrichten lassen wollen.
Drei Kinder bekam das junge Paar, von denen nur das zweite, Maria Theresia Walburga überleben sollte. Das dritte Kind starb ohne getauft zu werden und nahm die junge Mutter mit ins Grab.
Das Sterbedatum war der 8.1.1778. Die eh schon gespannten,
Beziehungen zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn eskalierten danach als Luckner das an seine Tochter übergebene Vermögen nach deren frühem Tod für seine einzige Enkelin sichern
wollte.
In einem Protokoll, dass die
Ursachen der Erbstreitigkeiten aufschlüsseln sollte, heißt es bei ihr, sie
lebte nicht gar 4 Jahr in der Ehe und ginge dem 6. Jenner 1778 in denen Kündts
Nöten samt dem Künd erpärmlichen auf. Im Rahmen der Vormundschaftsverhandlungen für das einzige Kind Maria
Theresa stellte sich heraus, dass Poschinger überhaupt keine
Anstalten machte, das Heiratsgut seiner verstorbenen Frau für seine Tochter zu
sichern, wie es eigentlich seine Pflicht gewesen wäre. Also begannen nun die Mühlen der Gerichte zu mahlen. Es folgten jahrelange Prozesse und Streitigkeiten zwischen Luckner und Poschinger. Nun
rächte es sich, dass Luckner das große Anwesen, seinen anderen beiden Kindern
Sebastian und Walburga zum Trotz, so billig hergegeben, ja fast verschenkt
hatte. Poschinger bekam
für sein eingebrachtes Heiratsgut von 7000 Gulden den Riesenbesitz Luckners,
den dieser nun nachträglich auf über 43000 Gulden schätzte, ein Schnäppchen
sozusagen. Es war ein von Luckner absichtlich falsch eingesetzter Vorzugspreis. Formal hätte
Poschinger seiner noch lebenden Tochter, Luckners Enkelin also, nur die 6891
Gulden, welche die Wertangabe bei der Verbriefung ausgemacht hatten, vertraglich
sicherstellen müssen, der Rest hätte ihm gehört.
Luckner aber ging
dagegen an und stellte nun auch nach außen hin zusammen, welchen Wert das
übergebene Objekt in Wirklichkeit gehabt hatte. Er begann dann auch einen
Gerichtsstreit um offene Rechnungen aus dem gemeinsam betriebenen Hopfenhandel
und um immer noch offen stehende Restsummen aus der Übergabe. Diese Streitigkeiten wurden ab 1778 vor Gericht ausgetragen und zogen
sich jahrelang hin. Die große Schwierigkeit der gegenseitigen Beweisführung lag
darin, dass in den ersten Jahren nach der Übergabe anscheinend noch viele
Geschäfte gemeinsam durchgeführt wurden bzw. Luckner Geschäfte machte und auf
Poschingers Pferde und Fuhrwerke zurückgegriffen hatte, die er ja eigentlich auch mit
übergeben hatte. Trotz des Rauswurfs Luckners hatten die beiden in den Jahren,
als Luckners Tochter noch lebte, wohl zunächst zu einem geschäftsmäßigen Miteinander
zurückgefunden.
Jetzt aber war Poschinger in der misslichen Lage, dass er als
vielbeschäftigter Mann, anders als sein Schwiegervater, weder die Zeit noch die
Lust hatte, auf all die vielen Klageschriften, und das auch noch fristgerecht,
zu antworten. In einem Fall ließ er ein Schriftstück ganze 9 Monate
unbeantwortet bei sich liegen und gab dann dasselbe dem Marktdiener Ander
Zadtler einfach wieder zurück mit der Aussage: er
näme keinen schriftlichen Prozess an, und brauche also diesen Schriftsatz nicht.
Poschinger kam nun allerdings von zwei Seiten in die Enge, da die
gesetzlichen Vorschriften für verwaiste Kinder, damals noch mehr als heute,
sehr genau waren. So war es auch zwingend vorgeschrieben, dass amtlicherseits
Vormünder gestellt wurden. Der Magistrat - Luckner war Amtskammerer - forderte eine gesetzlich vorgeschriebene Aufstellung des
Muttergutes, die dem Kind dann vertraglich gesichert werden musste. Zu Luckners Leidwesen hatte er aber selber eben dieses Muttergut, seinen anderen Kindern zum
Fleiß, so niedrig bewertet, um diesen ja nichts abgeben zu müssen. Es war also keine leichte Aufgabe, weder für Luckner noch für den Witwer
Poschinger. Das Ganze war nur insofern etwas vereinfacht, weil Poschinger im
Moment keinerlei Anstalten machte, sich
wieder zu verheiraten, das überlebende Mädchen also auf jedem Fall die
Alleinerbin wäre.
Um das ganze nicht zu einfach werden zu lassen, wiederverheiratete sich Samuel Luckner zum dritten Male und seine anderen Kinder befürchteten - er hatte eine sehr junge Rodingerin geheiratet und es war zu vermuten, dass er noch weitere Kinder bekommen würde - dass ihr mögliches Resterbe nun noch weiter vermindert werden könnte. Nachdem Poschinger zuerst ja gar nicht auf die Amtsschreiben reagiert
und Fristen einfach ignoriert hatte,
raffte er sich nun in der neuen Gemengelage doch zu einer ersten Antwort auf und stellte
seinerseits Gegenforderungen gegen seinen Schwiegervater auf.
Luckner war zuerst einmal empört darüber, dass dieses Schriftstück
angesichts der vielen Fristversäumnisse überhaupt angenommen worden war und
meinte, sein Schwiegersohn hätte manche der Erwiderungspunkte in Traume sich
vorgebildet.
Nachdem Luckner ja das Haus des Schwiegersohns Hals über Kopf hatte
verlassen und den Gschwandhof selber hatte renovieren müssen - was nach
Übergabevertrag ja die Aufgabe Poschingers gewesen wäre - listete Luckner nun alle Umbaumaßnahmen am
Gschwandhof auf und forderte sein zurückgelassenes Mobiliar ein. Luckner schrieb weiter, dass er die 600 Gulden Baukosten am Gschwandhof
in der Vergangenheit, mithilfe des Magistrats, seinem Schwiegersohn bereits
abgetrotzt habe. Ansonsten stellte er seinem Schwiegersohn kein sehr gutes Zeugnis in
Hinsicht auf dessen Wirtschaftsführung aus:
Er wünschte sich vom Magistrat eine Abweisung der unstichhaltigen
Schrift- und Rechnungsgedichte seines Schwiegersohns, der Marktrat sollte
vielmehr ihn, den Schwiegersohn, gehorsamist bitten, dass er sich einer
besseren Hauswürthschaft um so mehrer befleissen solle, und den Saufaus auf die
Seiten setzen solle.
Bei Poschinger hätten
- bis auf die Zunft der Zimmerleute alle anderen Zünfte das
Haus verlassen
- er würde daher nur noch die Hälfte Bier sieden würde.
- er würde nicht gegen das Wirtshaus in
Haus protestieren
- dasselbe galt auch für das neue
Wirtshaus des Försters in Chamerau
- die Gebühren seiner zwei Afterlehen, auch die Todfallreichung eines der
beiden, hätte er nicht eingefordert.
Er stellte ihm damit ein miserables Zeugnis aus und schloss, dass er
sich im Namen seiner Enkelin, als seines Notherben gezwungen sah, auf das
feierlichste zu protestieren. Schlussendlich aber stand bei einigen Streitpunkten, für die beide keine
Zeugen benennen konnten, nur noch Aussage gegen Aussage gegenüber. Beide
erzwangen vom jeweils anderen eine Aussage unter Eid, und ein jeder der Beiden
machte einen schriftlichen Vorschlag, was der andere zu beeiden hätte.
Michael Poschinger kam offensichtlich sehr unter Druck und versuchte
seinen Bruder zur Vermittlung einzuschalten. Diesen bezeichnet Luckner in
seinem abschließenden Schreiben, fast verächtlich nur als den Herrn Bruder
Weltpriester, welcher zusammen mit dem Kötztinger
Prokurator sich zur Vermittlung in seinem Haus einfand. Die Zusagen, die aufgrund dieser Vermittlung vereinbart worden waren,
hielt Johann Michael Poschinger aber
offensichtlich nicht ein, denn Luckner urteilte „er fände wahrhaft, dass es seinem
Schwiegersohn an einer standhaften Denkhartt nur zu sehr fehle“.
Gleichzeitig gestand er zu, dass die Streitigkeiten teilweise durchaus aus
unterschiedlichen Beurteilungen herrühren könnten und aufgrund der
verschiedenen vereidigten Aussagen kam er - Luckner - zu dem Schluss, dass sein
Schwiegersohn es entweder nicht besser wüsste oder sich nicht erinnern könnte
und schließt mit einer bemerkenswert altersweisen Schlusserklärung:
„Er, als ein alter Mann, der Gott zum Danke sein Brot hat, seine Kinder
bis auf einen Sohn verheiratet und versorgt hat, und mit einem Fuß schon am
Grabe steht, hat er sich entschlossen, ohne auch nur einen Gedanken an einen
unsicheren Eid zu verschwenden, auf alle seine Forderungen zu verzichten und
verlässt sich auf das gute Herz seines Schwiegersohnes, wozu ihn der
hochwürdige Herr Bruder überredet hätte“.
Luckner zog also sämtliche Klagen, gleich ob mündlich oder schriftlich,
zurück. Sein Ziel war es nun nur noch endlich Ruhe zu haben, „ein welches
eine Hauptsach ist“.. Diese Ruhe wünschte er seinem Herrn Schwiegersohn und
sich selbst in seinen besten Tagen, nebst aller freundschaftlichen Pflegung. Samuel
Luckner ist also der vielen Prozesse müde geworden und wollte wohl endlich
wieder freundschaftlichen Umgang mit dem Rest seiner Kötztinger Familie. Am 12.12.1791 wurde
der Vergleich zwischen den Beiden geschlossen und der Magistrat bat
sogleich die Regierung in Straubing um die Rücksendung aller Akten, der Deckel
sollte möglichst schnell geschlossen werden. Straubing ratifizierte wohl sehr
gerne den Vergleich und schickte die Akten und die Rechnung.
Der wahre
Hintergrund seines nachgiebigen Verhaltens lag aber wohl in einer neuen
familiären Entwicklung. Poschinger Johann Michael hatte eingewilligt, sein
Vermögen an seine Tochter zu übergeben. Damit hatte Luckner sein Ziel erreicht,
seine Enkelin war im vollständigen Besitz seines erarbeiteten Vermögens, und
nun konnte auch er nachgiebig sein.
Maria Theresia Poschinger
Am 13.10.1791, vier Tage nach ihrem 16. Geburtstag, erhielt das junge Mädchen Maria Theresia Poschinger den Riesenbesitz ihres Großvaters übereignet.
Georg Schrank und Maria Theresa Poschinger
Ein halbes Jahr später, am 19.6.1792 heiratete sie den aus Sicharting in Österreich stammenden Braumeister von Drachselsried Georg Schrank, der sich mit 50 Gulden anschließend auch das Kötztinger Bürgerrecht sichern konnte. Wolfgang Samuel Luckner, der Großvater, der so viel für die Rechte des Mädchen gekämpft hatte, starb am 11.8.1794.
 |
| Epitaph Samuel Luckners in der Kötztinger St. Anna Kapelle |
Schon im Jahre 1801 wird der Bürger und Bierbrauer Georg Schrank als Vizekammerer bezeichnet, ist also im Kötztinger Machtzentrum angekommen.
Die Kötztinger Bürger wünschen sich neue Zeiten. Das kgl. Landgericht ist aber -1807 - noch nicht bereit bzw. befugt, die herkömmlichen Regeln aufzuweichen, wie die des Verbots des Alleinehütens.
Georg Schrank klagt bei der Regierung und bringt vor: "Im verflossenen Monat August haben wir nach beendigter Ernte unsere eigenthuemlichen Stoppelfelder beweidet und jeder hat seiner Herde einen Hirten beigegeben, ohne dass wegen irgendeiner dadurch verursachten Beschaedigung nur die geingste Beschwerde gefuergt worden war, wurden wir von dem königlichen Landgericht vorgerufen und das Alleinehueten, wie es hieß als den bestehenden allerhöchsten Verordnungen zuwider schärfstens geahndet." Es war damals also noch verboten, seine eigene Tieren auf seinem eigenen Grund und Boden weiden zu lassen. Nach der erfolgten Ernte, die natürlich dem Grundbesitzer gehörte, waren die abgeernteten Flächen Teile der Almende, gehörten also der Allgemeinheit, und wurden gemeinschaftlich beweidet.
|
Maria Theresa und Georg Schrank hatten miteinander eine Vielzahl von Kindern: 1) Georg * 16.05.1797 + 16.05.1797
2) Kind * 24.08.1798 + 24.08.1798
3) Theresia * 15.11.1799 + 1833 ledig
4) Kind * 11.02.1801 + 11.02.1801
5) Ignatz * 29.01.1803 + 03.09.1870 der Gutsnachfolger
6) Anna Katharina * 27.07.1804 + 17.03.1805
7) Georg Benedikt * 05.10.1805 + 18.10.1810
8) Johann Georg * 16.11.1806 + 12.03.1807
9) Kind * 05.12.1807 + 05.12.1807
10) Joseph * 16.02.1810 + 29.03.1810
11) Johann Michael * 16.07.1811 Nach dem Tode Maria Therese Schranks, der Enkelin Luckners, heiratete Georg Schrank, in zweiter Ehe Geispiler Maria Salome, aus Griesbach, dem Ort aus dem auch seine Mutter stammte. Auch mit ihr hatte er noch eine Anzahl Kinder 1) Georg Benedikt * 15.12.1813
2) Johann Georg * 19.02.1817 + 12.12.1863 in Regensburg als Funktionär
3) Michael Georg * 25.04.1820 + 22.09.1863 als Privatier
4) Maria Katharina * 1823 + 27.06.1738 mit 15 ½ Jahren
5) Josef 25.07.1825 Bernhard Poschinger Glashüttenbesitzer aus Frauenau, der als Onkel bei allen Kindern als Taufpate eingetragen war, blieb in dieser Funktion auch bei den Kindern der zweiten Ehe Georg Schranks.
|
Es kam das Jahr
1801 und es war wieder Kriegszeit und die französischen Truppen waren im
bayerischen Wald. Erneut wurden Quartierlisten aufgestellt und
selbstverständlich logierten die Herrn Offiziere wieder im ersten Haus am
Platz. Der Major des Graf Morassischen Feldbataillons wohnte beim Schrank. Es zeigte sich also das alte Bild, wie
schon bei den Billichs im 30jährigen Krieg, beim Krieger im spanischen und beim
Luckner im österreichischen Erbfolgekrieg.
Als mit der Säkularisation Bayerns die bayerischen Klöster aufgelöst
werden, kam auch das Ende für das Kötztinger Priorat. Die Grundstücke und
Gebäude, die Möbel und die landwirtschaftlichen Geräte und Vorräte, alles wurde
versteigert und Georg Schrank erscheint auch auf vielen Versteigerungslisten.
Vor allem um landwirtschaftliches Gerät und
Erntevorräte bewarb er sich und bekam dann auch den Zuschlag für Heu, Grummet
und Werkzeug.
Um den Gschwandhof mit seinen Mietwohnungen
gab es als Folge der Säkularisation ebenfalls Streitigkeiten. Der Bezirksamtsarzt Dr. Reimer,
der sich verheiratet hatte, wollte gern aus seinen beengten Verhältnissen
ausziehen und hätte gerne den ersten Stock des Gschwandhofes bezogen. Dieser war aber an zwei pensionierte
Priestern, hier auch „Exbenediktiner“
genannt, aus dem säkularisierten Kötztinger Priorat vermietet. Dr. Reimer stellte nun über das Pfleggericht Kötzting
beim Magistrat den Antrag, dass die Priester ausquartiert würden, damit er eine
der, in Kötzting raren, 3 Zimmerwohnungen beziehen konnte. Das Pfleggericht
übte nun Druck auf alle Beteiligte aus, allein Georg Schrank stellte klar, dass
er einen gültigen Mietvertrag habe und
diesen auch einzuhalten gedenke. Auch die Priester verwiesen auf den Vertrag
und wollten nicht in das vorgeschlagene Ausweichquartier wechseln.Ein paar Jahre später wurden in Bayern die
ersten Gewerbekataster aufgebaut und Schrank Georg ist dort mit
seinen Konzessionen als Weinwirt, Bierbrauer und
Hopfenhändler aufgelistet.
Das Land Bayern wird vermessen, das Urkataster wird erstellt und alle
Gebäude und Häuser der bayerischen Ortschaften aufgeführt und nummeriert. Aus dem 1811 erstellten Häuser- und Rustikalsteuerkataster ist schön zu ersehen, WIE riesig der Grundbesitz des Anwesens geworden ist. Hier die erste von 5 Seiten daraus:
Markt Kötzting Nro XCV
Georg Schrank
Die gemauerte Wohn- und Gastgebbehausung mit Stallung, Schupfe und Brauhaus Hsnr 98
Der separiert stehende Stadel
Nutzanteil an den noch unvertheilten Gemeindegründen
Der aus dem Staatseigenthum erkauft und neu erbaute Zehent Stadel PlNr 204
Die aus den Klosterrealitäten erkaufte Schupfe beim Landgerichtlichen Zehentstadel PlNr. 210 1/2
Der Wurzgarten Plnr 217
Der Schmiedmarteracker PlNr 484 ab
Das Ackerl beim obern Kirchhof PlNr 1025
Der große Laimgassen Acker Plnr 594
Der kleine Laimgasse Acker PlNr 595
Die zweimähdige Hammerwiese PlNr 977
Die zweimähdige Auwiese PlNr 1078
Gemeindeanteil am Galgenberg PlNr 877
Zissleracker am Galgenberg PlNr 892
Der Dornacker PlNr 708
Das hintere Dirriglackerl PlNr 699
Das vordere Dirriglacker
Das vordere Schwarzweiherackerl Plnr 686
Das hintere Schwarzweiherackerl
Der Zipfelacker Plnr von Hsnr 70
Der Reitensteineracker Plnr 625
der Distelacker Vertauscht
Der Königacker Plnr 691
Der Plankengarten Plnr 600 und 601
Der Fleckacker Plnr 598
Der Hammeracker Plar 964
Die sogenannte Marktmühlerwiese Plnr 991
Der Acker auf der obern Au PlNr 983
Vom Strohhof: Plnr 766, 754 ab
Die zweimahdige Kastnerwiese Plnr 891
Die Fleckenwiese in 5 Abteilungen Plnr 608 und 912
Die Multerweiherwiese
Die zweimähdige schlechte Hausinger Weiherwiese PlNr 452
Die Dirrigl Wiese PlNr 698
Die Schwarzweiherwiese PlNr 706
Die Wulschanderlwiese PlNr 1678
Die Gehstorfer Weiherwiese
Das sogenannte Steinbachholz PlNr 585 Blaibach
Gschwandhof:
Das gemauerte Haus mit Stall und Stadel
Das 1te Ackerl in der untern Au PlNr 1083
Das IIte Ackerl auf der untern Au PlNr 1078
Das Ackerl beim ober Stadel PlNr 1001
Das zweimähdige Wieserl auf der untern Au PlNr 1069
Strohhofgründe PlNr 768 und 800
CVI das gemauerte Häusel wohnbar PlNr 226
Im beginnenden 19. Jahrhundert war das aktive und passive Wahlrecht an den Stand und an die persönliche Finanzkraft gekoppelt. Im Jahre 1818 wurde Georg Schrank als Brauer in die 5. Klasse der Landeigentümer eingeteilt. 1824 war er dann bereits einer der Wahlmänner für die bayerische Ständeversammlung, dem er von 1819 bis 1824 als Mitglied des Landtags angehörte.
1826 dann, kurz vor
der Übergabe seines Betriebes an den Sohn und noch vor dessen Heirat, musste auch er
sein “Produkt”, das Bier, prüfen lassen, denn die amtliche
Lebensmittelkontrolle beginnt zu greifen und die Kötztinger Wirtschaften werden
alle “visitiert”, Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
"Es fand sich wie bei allen übrigen,
Winterbier, gehaltvoll und Pfennig vergeltlich, zwar noch etwas jung, aber doch
so lauter, dass es auf die menschliche Gesundheit keinen schädlichen Einfluss
äussert."
Georgs zweite Frau, Salome, überlebte Ihren Mann und
verstarb erst am 15.12.1864 im Alter von 80 Jahren.
Schrank Ignatz und Nanette Pröll
Ignaz Schrank, der Sohn Georgs, erhielt am 15.10.1828 die
Heiratserlaubnis vom Magistrat für seine Hochzeit mit “Madame” Nanette Pröll, Tochter des Franz Pröll aus Wolferstein. Die Ehe wurde am 21.01.1829 geschlossen. Zwei Jahre später wurden die Urkataster Kötztings angelegt und dort ist
sein Anwesen mit dem Hausnamen Schrank aufgeführt, als ein Gasthaus mit
Bierbrau- und Schankgerechtigkeit und eigenem Brauhaus.
Schon im Jahre 1833 stellte Ignaz Schrank im Zusammenhang mit einem Straßenbauprojekt den Antrag, ein kleines Gässchen, dass auf seiner Gebäuderückseite seinen Besitz durchtrennte zun schließen und damit abzuschaffen. Seine Argumentation - Unterstützung erhielt er vom Kötztinger Pfarrer Henneberger und von Dr. Müller - war, das Gässchen sei "nutzlos für den Markt und nur Treffpunkt liederlichen Gesindels". Sein Antrag wurde abgelehnt, jedoch hat sich dadurch eine Lageplanskizze der Situation erhalten.
 |
| StA Kötzting AA VI 9. Deutlich zu erkennen, dass es die heutige untere Marktstraße noch nicht gegeben hatte. |
Mit der "neuen" Zeit
und den Möglichkeiten neue Gewerbe zu eröffnen, kommen einige Kötztinger
brauende Bürger auf die Idee, bei ihren Sommerkellern außerhalb des Marktes Biergärten auszurichten
und dort den Ausschank zu ermöglichen. Die beiden Bürger Hofbauer und
Dreger machten die Vorreiter und schon protestierte
Schrank Ignatz, dass „diese besonders in den Pfingstfeiertagen wo
wegen des sogenannten Pfingstlrittes eine große Conkurrenz von Menschen war,
einen sehr bedeutenden Zugang hatten“ und bittet, dass der Magistrat diesen Unfug abstellte. Seine Bitte war vergebens, den Zug zu gemütlichen Bierkellern und Biergärten konnte Ignaz Schrank nicht aufhalten; im Gegenteil er errichtete dann selber einen eigenen Biergarten.
Im Jahre 1837 reichte er einen Bauantrag ein, um auf seinem Kellergebäude ein zweites Stockwerk zu errichten und daneben ein Sommerhaus mit einer Kegelbahn zu bauen. Im Jahre 1840 kommte mit eben diesen Gebäuden zu einer Posse. Ignaz Schrank stellt den Antrag, die realen Kommunbrau und Tafernrechte von seinem Marktlehen Gschwandhof auf seine Sommerkellergebäude zu transferieren, was ihm auch erlaubt wurde. Im Jahre 1854 will Ignaz Schrank aber zurückrudern und dieses Recht wieder zurück auf seinen Gschwandthof übertragen.lassen. Nun ist guter Rat teuer, da die Akten unauffindbar find und niemand glaubt Schrank. Der Akt endet zwar hier, jedoch liegt ein Zettel dabei, der ergänzt, dass es im Jahre 1840 versäumt worden wäre, diesen Rechtetransfer überhaupt zu beurkunden, weshalb das Schankrecht immer noch auf dem Gschwandhof verblieben ist.
Natürlich kam es auch in diesem Wirtshaus zu Raufereien und eine solche wird in einer Vergleichsverhandlung im Jahre 1840 versucht zu schlichten, jedoch ohne Erfolg.
"1. November 1841. Auf Klage des Franz Lippert Bauer von Voggendorf gegen Alois Deschermeier Metzgerssohn, Johann Barth, Drechslerssohn, dann Ander Holzapfel Bürgerssohn v K und Wolfgang Vogl Knecht bei dem Bräuer Schrank und Franz Altmann Bauerssohn v Stadlern dermal Bräulehrling bei Schrank v K wegen erlittener Schläge und Genugtuung für vom Leibe gerissene Kleidung u dgl konnte allen Zuredens kein Vergleich erzielt werden." AA VIII-12
In diesen Vergleichsverhandlungen werden auch eher skurile Dinge verhandelt und knapp protokolliert:
"18. Jänner 1842: Georg Schrank Bräuersohn v K stellt Klage gegen Amalia Schwarz Marktschreiberstochter v K wegen Forderung aus einem Lottogewinn herrührend. Beklagte ist nicht erschienen."
Eben diese Amalia Schwarz sollte Jahre später dann Georgs Bruder Michael Schrank zum Traualtar führen.
Die Gebrüder Schrank waren aber nicht nur im eigenen Gasthaus unterwegs, und so findet sich ein längerer Vergleichsversuch mit dem Kötztinger Bader Costa in den Protokollen:
"Georg Costa bürgerlicher appr Chirurg u Geburtshelfer sowie Scribent bei dem hiesigen k Landgericht, tritt bei dem diesseitigen Vermittlungsamte gegen den Bierbrauerssohn Georg Schrank zu K deshalb klagbar auf, weil dieser Letztere im Gasthause des bräuenden Bürgers Georg Rötzer am 9. dies Monats Abend in Anwesenheit mehrerer Gäste die Behauptung aufgestellt habe, dass er, Georg Costa nur gegen Honorierung von Seite der Parteien seine Amtsgeschäfte bei dem k Landgericht dahier verrichte, und dass er Schrank ihm auch einen Kronentaler gebe wenn er einen mit Josef Dachs Bauer von Weissenregen abgeschlossenen Kaufvertrag sogleich auf ihn verbriefe. Diese Behauptung der Bestechlichkeit oder unerlaubter Geschenkannahme könne er Kläger sich durchaus nicht gefallen lassen und stellt die Klage dahin, dass der Beklagte sofort die ausgestossenen Behauptungen zurücknehme, sofort Abbitte leiste, sowie alle entstandenen Kosten bestreite. Georg Schrank bräuender Bürgerssohn v K der an ihn ergangenen mündlichen Vorladung zufolge persönlich erschienen, erinnert auf vorstehende Klage: Ich will nicht widersprechen, dass ich die von dem Kläger angegebene Behauptung resp gemachte Zusicherung eines Geschenkes von einem Kronentaler gegen Georg Costa gemacht habe, muss jedoch den ersteren Klagepunkt in Abrede stellen, dagegen habe ich auch die andere Behauptung nicht injurierend gegen Georg Costa gemeint sondern solche nur im Spasse ausgestossen. Nachdem unter diesen Verhältnissen eine gütliche Beilegung der Sache nicht erfolgen konnte so leitet Kläger eine Ausfertigung des Klagsattestes zur Verfolgung seiner Rechte auf dem civilen Rechtswege."
Der in diesem Protokoll angegebene Tatort: "Georg Rötzer" ist die spätere Bäckerei Clemens Pongratz, mein Elternhaus mitten am Marktplatz.
Auch auf dem Kellergebäude - heutige Holzapfelstraße - ging es manchmal deftig zu: "31. August 1843: Josef Auzinger Drechslerssohn v K stellt bei dem diesseitigen Vermittlungsamte gegen den Häusler Josef Haas v K deshalb Klage, weil ihm der letztere verflossenen Frauentage den 15. dies Monats Nachmittag auf dem Keller des Brauers Ignaz Schrank sein Beinkleid zerrissen habe wofür er Entschädigung von 4 fl 30 kr aufzeigt. Der Beklagte widerspricht die Klage. Kein Vergleich."
Auch Ignatz war,
wie sein Vater, Mitglied im Niederbayerischen Landtag und
kann dort in den Jahren 1845 bis 1848 nachgewiesen werden.
Er musste sich in dieser Eigenschaft den
Biertischparolen in Kötzting erwehren und strengte im Jahre 1848, wir sind kurz
nach der Märzrevolution, eine Klage wegen übler Nachrede an. 27. Oktober
1848: Ignaz Schrank bürgerlicher Bierbrauer und Posthalter zu Kötzting bringt
gegen den praktischen Arzt Dr. Seydel dahier Beschwerde an, dass derselbe sich
unlängst im Gasthause der Witwe Ring abends in öffentlicher Gesellschaft gegen
die bayer. Deputiertenkammer äußerst beleidigender Ausdrücke bedient habe. Ignaz Schrank als Mitglied dieser Kammer
könne sich diese ehrenrührigen Äußerungen nicht gefallen lassen, stellt deshalb
gegen den praktischen. Arzt Dr. Seydel Klage auf Widerruf und Abbitte.
Der Beklagte erinnert, dass er bei
fraglicher Gelegenheit nur im allgemeinen mitunter auch über die bayer.
Deputiertenkammer bezüglich ihrer gefassten jüngsten Beschlüsse, die er mit seiner
Ansicht nicht vereinigen könne, gesprochen habe, dass er an den Kläger Ignaz Schrank
als Mitglied dieser Kammer gar nicht gedacht habe, folglich ihn auch nicht
beleidigen konnte. Er erklärte sofort, dass er gegen Ignaz Schrank bezüglich seiner
Ehre am fraglichen Abend weder etwas geäußert habe, noch äußern könne und ihn
durchaus nicht beleidigen wollte. Durch diesen Widerruf stellt sich Ignaz
Schrank zufrieden.
Der Hintergrund dieser Beschwerde lag mit
ziemlicher Sicherheit darin, dass die neue Regierung nach der Revolution eine
ganze Reihe von neuen Gesetzen erlassen hatte. Carl von Paur fügte
in seiner Chronik in einer langen Listen die Neuerungen an, die aus München
angekommen waren und sicherlich dem einen oder anderen Bürger nicht passten.
Das Postzeitalter beginnt. Mit Schrank Ignatz trat nicht nur eine neue Generation auf dem Anwesen an, sondern es kam auch eine neue Zeit. Das Postzeitalter hatte in Kötzting seinen Einzug gehalten und Schrank Ignatz war der „Briefsammler“. Während bis dahin der Brief und Paketdienst mit Boten von Fall zu Fall erledigt worden war, die für jede Dienstleistung einzeln und in der Regel vom Empfänger bezahlt worden war, führte die Königliche Post=Brief=Sammlung das ganze jetzt systematisch durch. Die Boten stellten die Verbindung Kötztings zu den umliegenden Taxischen Postanstalten her. Am 1. April 1830 wurde nun die neue Sammelstelle eröffnet und wöchentlich zweimal, Dienstags und Freitags, wurden die bis kurz vor dem Ablieferungstermin abgegeben Postsachen, die sich zum Versand eigneten, zu einem Postpaket vereinigt und abgesandt.
Zweimal die Woche ging Post ab und zweimal die Woche kam Briefpost an und konnte am drauffolgenden Tag, also dann Mittwochs und Samstags, beim Schrank abgeholt werden. Diese Beförderungsregeln teilte Ignatz Schrank schriftlich dem Magistrat mit. Eine persönliche Zustellung scheint damals noch nicht üblich gewesen zu sein. Zwei Jahre später erkundigte sich das königliche Oberpostamt München beim Landgericht Kötzting, ob man erstens mit dem gegenwärtigen Briefsammler Schrank zufrieden sei und zweitens, ob die Einwohner das neue System dem alten mit der Bötin Anna Heindl vorzögen. Beide Male
bestätigte der Magistrat dem Pfleggericht auf Anfrage, dass die Bevölkerung das
neue Angebot schätzen würde. Im Frühjahr 1845
wurde aus den zwei An- und Ablieferungen pro Woche dann eine tägliche
Versorgung. Ab dem Frühjahr noch als täglicher Botengang wurde im Herbst 1845
dann eine tägliche „Karriolfahrt“ zwischen Kötzting und Cham eingerichtet.
Hinzu kam zusätzlich zur Briefbeförderung auch ein Paketpostdienst mit eigner
Poststallhaltung.
Das mit Kötzting
durch tägliche Karriolfahrten – später durch Postomnibusfahrten- verbundene
Cham hatte damals noch keine Bahnverbindung und bekam erst 1853 durch eine
„Karriole“ über Roding und Falkenstein direkte Pferdepostverbindung mit
Regensburg und der großen weiten Welt. Erst die Eröffnung
der Bahnlinie Schwandorf – Furth im Jahre 1861 brachte auch den Kötztingern
eine durchgreifende Verbessehrung und Beschleunigung des Postverkehrs.
Der erste
„Briefsammler“ Kötztings, der Brauereibesitzer Ignaz Schrank, wurde nun durch
die Poststallhaltung der erste Posthalter in Kötzting. Dadurch ergab sich dann
auch die Bezeichnung seines Anwesens als „Zur Post“.
Und es gab dann auch schon mal Ärger mit der bis dahin unbekannten Methode eines "Briefportos": "22. Oktober 1846: Ignaz Schrank Postexpeditor zu K tritt gegen den Schullehrer Heinrich Arent von da deshalb klagbar auf, weil der Letztere sich auszustreuen erlaube, dass er ihn als Postexpiditor mit einem Briefporto zu betrügen gesucht habe und bittet den Heinrich Arent zum Widerruf und zur Abbitte zu veranlassen. Der Beklagte erinnert, dass der fragliche Brief von Österreich als frei an ihn gelangt sei und da derselbe mit Briefporto belegt war so habe er sich nur bei der Frau des Klägers deshalb erkundigen lassen indem er der Ansicht war dass vielleicht der einen Unterschied gemacht habe und nachdem er Aufschluss dahin erhalten, dass das fragliche Porto von der Grenze bis hierher erlaufen sei, habe er sich an und für sich zufrieden gestellt. Deshalb glaube er auch Herrn Posthalter Schrank nicht beleidigt zu haben und für den Fall, dass seine Äusserung verstellt an den Kläger gelangt sei erkläre er im voraus dass er gar nie eine böswillige Absicht oder Ausstreuung im Sinne gehabt habe."
|
In dieser Zeit, der
Epoche des Biedermeier pflegten die königlichen Beamten des Pfleggerichts und
die Honoratioren des Marktes sehr gute Beziehungen, die auch über die
Revolutionszeiten anhielten. Allein 15 Gulden gab der Markt Kötzting 1846 aus, um den Saal des Posthalters Schrank für den Empfang und die Installation des neuen Landrichters standesgemäß dekorieren zu lassen. Im Sitzungsprotokoll des Marktes findet sich ein ausführlicher Auftrag für diese Festlichkeit, die Musik und den Saalschmuck. Der neue Landrichter war niemand anders als Carl von Paur. Diese gute Stimmung untereinander wurde erst wieder durch die Wirren der Kirchenspaltung nach und mit dem vatikanischen Konzil 1870 getrübt.
Vorerst aber war
alles in guter Untertanenordnung und der Ausdruck „beim Schrank“ wurde in
Kötzting zum Synonym für bürgerliche Gemütlichkeit. Carl von Paur, Landrichter in Kötzting, bestätigt genau dies
in seiner Chronik und führt weiter aus, dass es vorzugsweise das Schrank’sche Gasthaus
„zur Post“ gewesen war, wo man sich so gerne zusammen fand, da die Besitzer, der
Brauer Ignatz Schrank und seine Frau Anna, treffliche Wirtsleute waren, wie man sie selten findet,
besonders die Frau, „die Spenderin der guten Gaben“ die stets Anteil
nahm an dem Schicksale eines jeden einzelnen Gastes und gar vielen in guter
Erinnerung ist und bleiben wird.
Zu dieser
Geselligkeit hat aber auch der k. Gerichtsarzt Dr. Karl Müller, genannt
„Saumüller“, während seines 25jährigen Aufenthaltes in
Kötzting von 1833 bis 1858 - ein Mann voll Leben und listiger Bosheit -,
wie Karl von Paur schreibt, wesentlich beigetragen. Dr. Müller, der bereits mehrere
Gedichtbändchen veröffentlicht hatte, brachte im Jahre 1858 ein Büchlein heraus, in
welchem er Gebrauchslyrik aus und über seine Kötztinger Zeit zusammengestellt
hatte und von denen einige ganz besonders diese oben angesprochene Geselligkeit
ausdrückten. (MÜLLER, Dr. Carl Gedichte aus seiner letzten Zeit in Kötzting Druck J. Jakob Kötzting von 1855 Seite 29 gewidmet dem ehemaligen Kötztinger Rentbeamten Dexel, der nach Waldsassen versetzt worden war.)
 |
| Sammlung Pongratz |
|
Auszüge aus Gedichten Dr. Müllers, die einen Bezug zur Familie Schrank haben
 | | Der Kötztinger Amtsphysikus Dr. Müller |
Sehnsucht nach Kötzting oder
Stoßseufzer zu Waldsassen im Klostergarten Sonst saß ich im Keller beim G’vattersmann Schrank
Und schlürfte mit Wollust den göttlichen Trank
Da saß ich still sinnend ein glücklicher Mann
Und dacht nicht der Zukunft wies einst werden kann.
Es eilte die Zeit mir so herrlich dahin!
Oh Kötzting o Kötzting stets bleibst mir im Sinn...... In einer anderen Geschichte in Reimform, die ganz im Schrankenkeller spielt schildert er die Stimmung dort gleich am Anfang des Gedichtes. Die Schinkenpartie Im Schrankenkeller
Den 10. Juli 1838 Ungefähr vor 14 Tag
sitz ma am Nachmittag
im Schrankenkeller,
gar nix fideler. Thun a wenig Kegelscheibn
bloß um d’Zeit vertreibn
nur grad in d’ Pfennig,
net weg’n Gewinn...... oder an anderer Stelle berichtet er von einem, für ihn allerdings schmerzlichen, Sprung über ein Lagerfeuer, wofür der Brauer Schrank einen Schinken als Belohnung ausgesetzt hatte. Doktorssprung zu Kaitersberg
Bei Kötzting am 29.06.1845 Wer wagt den Sprung vom Felsen dort
Bis hierher, übers prasselnde Feuer
Es ist nicht so ungeheuer
Den Schinken so rosenrot schneide ich hier
Und überdies auch noch eine Maß Bier
Soll haben der hier ohne Zagen
Den Sprung dort vom Felsen will wagen
So ruft der Schrank und um ihn her
Da standens mit gierigen Blicken
Der Schinken war zum Entzücken
Und des herrlichen Gerstensafts silbriger Schaum
Bei glühender Hitze für Zunge kaum
Was Lockendes kann es nicht geben.......
|
Ignaz Schrank, der
bereits im April 1837 zum ersten Mal als Landrat (nicht zu verwechseln mit einem heutigen Landrat. Schrank war abgeordneter „Rat“ im Landtag) in den Landtag gewählt worden war, schaffte
es auch ein zweites Mal und vertrat seine Marktgemeinde anschließend auch in
der nächsten Wahlperiode ab 1844.
Dem Pfingstritt, dem Hauptereignis im Jahreskalender Kötztings fühlte sich Ignaz
Schrank ebenfalls eng verbunden. 1828, kurz vor seiner Heirat, war er selbst Pfingstbräutigam gewesen. Später als Brauereibesitzer stellte er immer wieder seine Pferde dem Kooperator und der Zugspitze zur Verfügung.
Er verlangte zwar nichts für die Pferde, stellte aber die Arbeit seiner Knechte dem
Markt Kötzting in Rechnung, wodurch wir überhaupt Kenntnis von dem Vorgang
haben. Die Rossknechte Schranks erhalten für die bey dem Pfingstritte für den Herrn Cooperator
p. nöthigen Pferde laut Schein 1 Gulden 36 Kreuzer. (Marktrechnung von 1840) 1843 sind
zusätzlich auch noch die Pferde für die Trompeter genannt und 1844 stellt er dann schon 4 Pferde
für den Priester, den Mesner und
die Trompeter. (Kosten zusammen 2 Gulden 24 Kreuzer)
|
Der Kreuzträger beim Pfingstritt Aus diesem Entgegenkommen der Familie Schrank hat sich eine Tradition entwickelt, die auch von den Gutsnachfolgern auf dem Anwesen beibehalten worden ist und dies auch in Kriegszeiten und in der schweren Zeit des Dritten Reiches. Selbst nach dem Übergang des Komplexes in die Hände des Bezirks der Oberpfalz in der 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, wurde dem Herkommen Rechnung getragen und die ehrenvolle und durchaus schwere Aufgabe des Kreuzträgers auf die Familie des „Schmidtbräuschweizers“ (Heutzutage die Familie Schedlbauer) übertragen, die diese Funktion nun bereits in der zweiten Generation beibehält.
|
Ignatz Schrank und seine Frau hatten zwei
Töchter. Anna Maria Julia Theresa geboren am 06.06.1830 in Kötzting mit den
Taufpaten Michael Poschinger, Gutsbesitzer aus Frauenau, und Theresia Schrank, der Schwester des Vaters aus
Kötzting.
Als zweite Tochter wurde Maria Anna am
14.05.1835 in Kötzting geboren. Diesmal
waren die Taufpaten Maria Poschinger, Gutsbesitzersgattin aus Frauenau, und
Salome Schrank, die
verwitwete Stiefmutter aus Kötzting.
Beide Mädchen wurden in Kötzting auch als
Pfingstbraut auserwählt. 1841 wird uns ein Fräulein
Schrank Therese übermittelt, die bereits im zarten Alter von 11 Jahren(!) als
Pfingstbraut fungierte. Im Jahre 1851 war dann Schrank Anna die Pfingstbraut. Therese Schrank
heiratete übrigens Jahre später ihren Pfingstbräutigam, den Hammerwerksbesitzer von Harras
und Kötztinger Bürger Josef Windorfer.
Schrank Michael und Amalie Schwarz
Schrank Michael, der Brauerssohn und spätere
Bürgermeister Kötztings, erhielt am 05.10.1842
vom Magistrat Kötzting die Heiratserlaubnis und heiratet Amalie Schwarz, die Tochter des Marktschreibers von
Kötzting. Im Jahr 1843 erwarb er auch das Bürgerrecht. Michael Schrank übernimmt aber noch nicht das väterliche Anwesen, das im 1841 erstellten Grundsteuerkataster so beschrieben wurde: "Das Gasthaus mit realer Tafern-, Bierbrauerei und Schankgerechtigkeit beym eigenen Brauhaus im Großen und im Kleinen."
Einschub
Nach der Übergabe von Ignaz auf den Sohn Michael lässt Ignaz Bruder Georg den Weißenregener Bauern Dachs vors Kötztinger Vermittlungsamt laden. Dieser Josef Dachs kommt auch in Dr. Müllers Gedichtsammlung vor und muss ein selten grobes Exemplar von Mensch gewesen sein.
Hier zunächst die Anklage Georg Schranks:"13. Juni 1847: Georg Schrank Privatier dahier tritt gegen den Binder Josef Dachs von Weissenregen klagbar auf, weil Letzterer am vergangen Sonntage den 20. Dies im Gasthaus der br Bürgers Josef Weiss seine goldene Uhrkette zerissen habe und verlangt
eine Entschädigung von 30 fl. Da der Beklagte sich durchaus zu keiner Schadloshaltung herbeilässt so bittet der Kläger um Klagsanweisung."